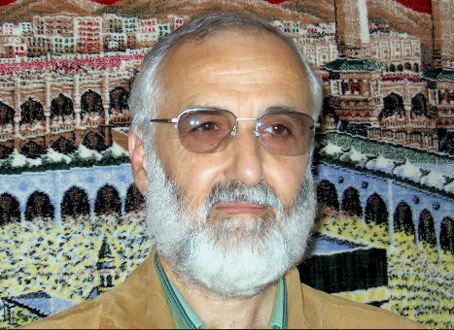© Foto by Beat Stauffer, OnlineReports.ch
"Dialog ist möglich": Basler Moscheeleiter Nabil Arab
Zum guten Glück "nur Luft-Bomben"
Auf den Spuren militanter Islamisten in der Schweiz
Von Beat Stauffer
In London, Amsterdam und Madrid haben junge muslimische Extremisten, die einen westlichen Lebensstil pflegten und als integriert galten, das bisher Undenkbare getan und den Terrorismus ins Herz Europas getragen. Es stellt sich die Frage, ob Bin Laden auch in der Schweiz willige Helfer hat. Eine Erkundigung in schwierigem Gelände.
Ist davon auszugehen, dass auch in der Schweiz eine kleine Minderheit von jungen Muslimen zu einem radikal-extremistischen Verständnis des Islam neigen oder gar, nach den Worten des amerikanischen Islamwissenschafters Bernard Lewis, als "Bin Ladens Helfer" anzusehen sind? Wer versucht, in dieser Frage etwas mehr Klarheit zu gewinnen, wird schon bald auf grosse Hindernisse und nicht selten auf eine Mauer des Schweigens stossen. Verantwortliche von Moscheevereinen und Imame, die allenfalls direkten Kontakt zu solchen Jugendlichen haben könnten, neigen meist dazu, die Existenz von radikalen Elementen in ihren Moscheen kategorisch zu bestreiten. Individuen oder Gruppen, die einer radikal-islamistischen Ideologie anhängen, haben ihrerseits allen Grund, sich angesichts des heutigen Klimas in der Bevölkerung unsichtbar zu machen.
Ausdruck tiefer Kränkung
Es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob sich solche militante Islamisten überhaupt an ernsthaften Gesprächen über ihre Ideen, ihre Motive und ihre Sicht der Dinge beteiligten. Eine Magisterarbeit an der Universität Trier, welche die "Etappen und Begünstigungsfaktoren des terroristischen Radikalisierungsprozesses" untersuchte, stiess jedenfalls auf derart grosse Hindernisse, dass die Verlässlichkeit ihrer Resultate zumindest in Frage gestellt werden muss. So durfte der Autor, der selber muslimischen Glaubens ist, seine Gespräche mit den militanten Islamisten nicht auf Tonband aufnehmen und musste zudem sämtliche Spuren verwischen, welche die befragten Personen identifizierbar gemacht hätten.
Erschwerend kommt hinzu, dass auch in gewissen muslimischen Kreisen in der Schweiz bis heute Verdrängung und Beschönigung angesagt ist. Es gebe keine Dschihadisten*, sondern bloss Einzeltäter, erklärte etwa kürzlich der Berner al-Jazira-Korrespondent Tamer Aboalenin gegenüber der "Basler Zeitung", und auch Kolumnisten wie Frank A. Meyer seien genau genommen "Hassprediger". Dass eine solche "Analyse", die mehr von einer tiefen Kränkung als von nüchternem Verstand getragen scheint, nichts zu einer Lösung des Problems beiträgt, sondern bloss vernebelt, ist augenfällig. Andere sehen die Lösung darin, zu schweigen, wohl in der Hoffnung auf eine bessere politische Grosswetterlage. So erklärte etwa der Zürcher Muslim-Aktivist Fatih Dursun, der auch Mitglied der Eidgenössischen Antirassismuskommission ist, er habe "kein Interesse" an einem Gespräch mit OnlineReports.
Wissenschaftliche Untersuchungen fehlen
Eine vergleichbare wissenschaftliche Untersuchung über die Radikalisierung junger Muslime in der Schweiz existiert nach den vorliegenden Informationen nicht. Eine Arbeitsgruppe von Islamwissenschaftern und Soziologen (GRIS), so erklärte der Lausanner Politikwissenschafter Ahmed Benani, habe kürzlich eine entsprechenden Studie über die Befindlichkeit der Muslime in der Schweiz in Angriff genommen; Resultate liegen allerdings noch keine vor.
Unbestritten ist aber, dass auch in der Schweiz eine Reihe von Moscheen existieren, in denen erklärte Islamisten verschiedenster Richtungen verkehren. Regelmässig denunzieren denn auch gemässigte Muslime entsprechende Tendenzen bei den Behörden. Es gebe eine ganze Reihe von islamischen Zentren, wo Imame "ein Milieu schaffen, in dem erst eine Radikalisierung stattfinden kann", sagt Fatima (Name geändert), eine junge Islamwissenschafterin, die selber muslimischen Glaubens ist. Imame, die sich nicht unmissverständlich von radikalen Ansichten distanzierten und ständig die "Opferhaltung" betonten, schürten dadurch Wut und Frustration gerade bei ungefestigten Muslimen der zweiten Generation. Eine selbstkritische Haltung und eine offene Auseinandersetzung werde dadurch in keiner Weise gefördert. Gemässigte Muslime hüteten sich davor, solche Moscheen überhaupt zu betreten.
Kein Wort über gravierende Attentate
Was mit dem Schüren von Gefühlen der Frustration und Wut gemeint sein könnte, lässt sich etwa auf der Homepage des "Centre Islamique de Genève" nachvollziehen: Da werden unter der Rubrik "Dernières Actualités" das Massaker von Srebrenica von 1995 und die vor Monaten bekannt gewordene Schändung des Korans durch amerikanische Soldaten erwähnt, die Attentate von London und Scharm El Scheich sind den Verantwortlichen hingegen keine Zeile wert.
Namen von Moscheen oder von Imamen mögen allerdings weder Fatima noch andere Gesprächspartner nennen. Dies ist in den vielen Fällen auch problematisch. Denn in einer Moschee können durchaus Extremisten verkehren, ohne dass dies dem Wunsch der Moscheeleitung oder des Imams entspricht. Einzelnen Imamen - so darf vermutet werden - wäre es wohl noch so recht, wenn Scharfmacher und Hetzer anderswo hingingen. Denn sie selber sind es, die den Kopf hinhalten müssen, wenn ihre Moschee den Ruf eines Horts von Extremisten gewinnt.
Extremisten werden "aus dem Zentrum gewiesen"
Vieles weist aber darauf hin, dass es in erster Linie islamische Zentren sind, in denen Gläubige aus arabischen Ländern verkehren. Ebenso sind junge Muslime arabischer Herkunft sehr viel stärker gefährdet, in den religiösen Extremismus abzugleiten, als solche aus der Türkei oder dem Balkan.
Zu diesen Zentren gehören etwa die islamische König Fayçal-Stiftung in Basel und das islamische Zentrum an der Rötelstrasse in Zürich. Sowohl Youssef Ibram, der mehr als zehn Jahren lang an der Rötelstrasse als Imam wirkte, wie auch Nabil Arab, Direktor der erwähnten Moschee an der Basler Friedensgasse, sind in dieser Hinsicht kategorisch: Wenn Gläubige extremistische, intolerante Ansichten äusserten oder andere zu Handlungen überreden wollten, die gegen schweizerische Gesetze verstossen, würden sie umgehend aus dem Zentrum gewiesen.
Solche Vorfälle seien allerdings selten, erklären beide Befragten übereinstimmend. Seit dem Jahr 1998, als eine extremistische Gruppe namens "Takfir wal Hidschra" im Zentrum versucht habe zu agitieren, habe es an der Rötelstrasse keine derartigen Probleme mehr gegeben, sagt Ibram, der heute als Imam der Genfer Moschee von Petit-Saconnex wirkt. Anhänger der Kaida habe er in der Schweiz nie kennen gelernt. Auch mit anderen radikalen Gruppen pflege er keinerlei Kontakte, und er wisse auch nicht, wo sie sich träfen.
Hass auf USA und Grossbritannien
Beide Befragten räumen aber ein, dass, insbesondere unter jugendlichen Moscheegängern, viel Frustration und, so Ibram, "ein grosser Hass" auf die USA und Grossbritannien zu spüren sei. "Viele jungen Muslime sind extrem frustriert, weil sie in der Schweiz ihre Lebensziele nicht erreichen können", sagt Arab. Einige wenige von ihnen äusserten sich denn auch manchmal verbal auf radikale Weise. Doch solche "Luft-Bomben" seien nicht wirklich ernst zu nehmen. Arab weist schliesslich darauf hin, dass Moscheebesucher, die durch radikale Haltungen auffielen, manchmal auch Mitarbeiter von Geheimdiensten arabischer Staaten seien, die auf diese Weise islamistische Regimegegner identifizieren wollten. Zumindest in einem Fall habe er dafür auch Beweise.
Ein etwas anderes Bild zeichnet Fatih (Name geändert), ein muslimischer Aktivist aus der Region Luzern, der nach eigenen Angaben "sehr viele junge Muslime" und die meisten islamischen Zentren in der Zentralschweiz kennt. Ein "Hang zu extremen Haltungen", so erklärt Fatih, gebe es auch unter Jugendlichen in der Zentralschweiz. Diese Strömung sei der "Neosalafiyya" zuzurechnen, die sich klar in zwei Zweige unterteilen lasse: In einen bloss verbal radikalen Zweig und in einen "verschwindend kleinen" gewaltbereiten Zweig, die Dschihadisten. Während verbal-radikale Neosalafisten in der Region Luzern durchaus existierten, kenne er keine jungen Muslime, die selber gewaltbereit seien oder zur Gewalt aufriefen.
Irregeleitete Jugendliche
Nach Fatihs Beobachtungen stellen sie ein neues Phänomen dar, das in dieser Ausprägung noch vor wenigen Jahren nicht existiert habe. Ihre Ideologie sei eine "Fehlentwicklung", ja eine "Verirrung", und bei ihren Verfechtern stelle er immer wieder eine mangelhafte Kenntnis des Islam fest. "Diese jungen Leute sind verblendet. Sie leben in ihrer eigenen, abgeschotteten Welt und glauben, sie seien im Besitz der absoluten Wahrheit", sagt Fatih. "Moderaten Muslimen werfen sie vor, ungläubig zu sein."
In kleinen Zirkeln beschäftigten sich diese Neo-Salafisten mit der Frage, wie sie islamisch korrekt leben könnten, und bestätigten sich gegenseitig in ihren radikalen Ansichten über die Dekadenz des Westens, über die Notwendigkeit des "Dschihad"und über die künftige Weltherrschaft des Islam. Sowohl von der "Ideologie" wie vom Profil der Anhänger her sieht Fatih zahlreiche Parallelen zu rechtsradikalen Strömungen. Es handle sich meist um marginalisierte junge Menschen, die beruflich und privat wenig Chancen im Leben hätten.
Fatih ist überzeugt davon, dass diese jungen Neosalafisten nicht durch irgendwelche "Hassprediger" in Moscheen aufgestachelt worden sind. Solche gebe es in der Region Luzern nämlich gar keine. Nur ein einziger Fall eines saudischen Imams ist ihm bekannt, der – als Gastprediger – radikale Ansichten vertreten hatte und sogleich auf klare Ablehnung, ja Empörung bei den Gläubigen gestossen war. Die Neosalafisten, die er kenne, seien vielmehr via Internet radikalisiert worden. Aus diesem Grund erachtet es Fatih als viel wichtiger, die betreffenden Webseiten statt die Moscheen zu überwachen.
Für die Schweiz "kaum eine Gefahr"
Für die Schweiz sieht Fatih kaum eine Gefahr, Ziel terroristischer Anschläge zu werden. Die Situation unterscheide sich in entscheidenden Punkten von derjenigen in Frankreich, Deutschland oder Grossbritannien. Diese Auffassung teilen auch die befragten Imame und Moscheeverantwortlichen. Die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, die sozio-ökonomischen Bedingungen sowie das Fehlen eigentlicher Ghettos, so der Direktor der Genfer Moschee von Petit-Saconnex, Hafid Ouadiri, lasse es als "undenkbar" erscheinen, dass Gewaltakte in der Schweiz geschehen könnten.
Ist aber ein Dialog mit militanten Islamisten über ihre politische Haltung überhaupt möglich? Auf jeden Fall, meint der Basler Moscheeleiter Nabil Arab. Ein Imam sei eine "Respektsperson" und verfüge über eine grosse Autorität. Er könne deshalb auch junge Menschen, die vom rechten Weg abgekommen seien, wirkungsvoll beeinflussen. Ähnlich argumentieren auch Verantwortliche und Imame anderer islamischer Zentren.
Neosalafisten "kaum mehr ansprechbar"
Wesentlich skeptischer lautet die Einschätzung des Muslim-Aktivisten Fatih. "Diejenigen, die innerhalb der Neosalafiyya verkehren, sind kaum mehr ansprechbar", sagt Fatih. Aus diesem Grund erachtet er es als wichtig, gefährdete junge Muslime abzuholen, "bevor es soweit kommt". In einer Anfangsphase könne es noch gelingen, die Betreffenden zu kontaktieren und die Radikalisierung abzuwenden. Man müsse ihnen deutlich machen, "wie wackelig ihre Argumente" seien und diese auf der Basis des islamischen Glaubens widerlegen. Dies könne aber nur gläubigen, praktizierenden Muslimen gelingen. "Verwestlichte Muslime", sagt Fatih, "haben zu solchen Jugendlichen überhaupt keinen Draht mehr!" In diesem Punkt trifft sich Fatih mit Youssef Ibram: Nur gläubigen Muslimen, sagt dieser, sei es möglich, extremistische Tendenzen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft einzudämmen.
Einiges spricht für diese Hypothese. Falls sie zutrifft, müsste dies konsequenterweise zu einer positiveren Beurteilung von konservativen sowie gemässigt islamistischen Bewegungen führen: Denn nur sie wären demnach in der Lage, das Gewaltpotenzial extremistischer Gruppierungen und Individuen zu neutralisieren.
Zerrissen zwischen Wohlstand und Familien-Erwartung
Laizistische Muslime legen hier allerdings Widerspruch ein. Zu ihnen gehört Saïda Keller-Messahli, Initiantin und Präsidentin des "Forums für einen fortschrittlichen Islam" FFI. "Wenn jemand empfänglich wird für eine durchstrukturierte, religiöse Ideologie, dann bedeutet dies, dass etwas mit dieser Person nicht stimmt", gibt Keller-Messahli zu bedenken.
Die Wurzeln des Problems liegen für die FFI-Initiantin in der extrem schwierigen psychologischen Situation, in der sich viele muslimische Secondos befinden. Diese jungen Menschen seien zerrissen zwischen den Anforderungen und Versuchungen der westeuropäischen Wohlstandgesellschaften und den Erwartungen ihrer Familie, die oft noch von islamischen Traditionen geprägt sind. "Viele zerbrechen an dieser Spannung", sagt Keller-Messahli. Jugendliche spürten, dass auch extremer Konsum und andere Angebote der heutigen Spassgesellschaft diese Spannung nicht zukitten könne. Sie flüchteten sich in der Folge in eine Ideologie, die ihnen einen Halt und klare Richtlinien anbiete und würden auf diese Weise zu islamistischen Eiferern oder - im schlimmsten Fall - gar zu Terroristen.
Um dieses "explosive Potential" zu entschärfen, sieht Keller-Messahli einen ganz anderen Weg als die Imame: Es sind Gesprächgruppen und Foren, in denen die desorientierten Zweitgenerations-Jugendlichen über ihre Probleme frei sprechen könnten. Auf diese Weise, ist Keller überzeugt, liesse sich "enorm viel Druck weg nehmen". Die jungen Männer - um solche handelt es sich in den meisten Fällen - würden so in ihrer inneren Not nicht allein gelassen und hätten die Chance, einen persönlichen Reifungsprozess statt eine Radikalisierung durchzumachen, die sie letztlich ins Verderben führe.
Ein neuer Tonfall
Dieser Vorschlag mag etwas utopisch anmuten. Doch es ist wohl sinnvoll, alle Möglichkeiten zu prüfen, um fehlgeleitete junge Muslime davon abzubringen, der nihilistischen Ideologie eines Bin Laden zu folgen. Denn die vielfältigen Konsequenzen von Anschlägen in einem Land wie der Schweiz, das bisher von Terrorismus verschont geblieben ist, wären in jeder Hinsicht verheerend.
Auf muslimischer Seite, so ein langjähriger Beobachter, haben dies viele begriffen. Da ist plötzlich ein neuer Tonfall zu hören. "Leute, die extremistische Ideologien verbreiten und den Islam verkrüppeln, sind (aber) nicht meine Brüder", lässt der Islamische Dachverbands der Region Luzern die Öffentlichkeit wissen. "Die haben in unserer Gemeinschaft nichts zu suchen. Raus mit ihnen!" Zumindest diese klare Sprache wäre Anlass für eine Spur Optimismus.
* Radikale Islamisten, die den bewaffneten Kampf, den "Dschihad", gegen den Westen und generell gegen "Ungläubige" führen wollen.
** Der Salafismus steht für die Rückbesinnung auf den frühen, vermeintlich "reinen" Islam und richtet sich heute auch gegen westlichen "Imperialismus" und gegen muslimische Herrscher, die die nicht buchstabengetreu dem islamischen Recht folgen.
13. August 2005
Weiterführende Links: